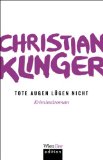„Rosa“ von Silvia Pistotnig
Fortsetzung der neuen Serie: Eselsohren exklusiv.
Zuerst dachte ich an Sehschwäche, ähnlich der Schmerzen, die oft auftauchen und wieder verschwinden, als wäre nichts passiert. Ich rief meine Freundin an, diese glaubte mir zuerst nicht, am Ende war sie besorgt. Die Freundin riet mir, einen Arzt zu konsultieren. Ich rief ich meine Schwester an, dann ging ich alle Namen am Handy durch und entschied mich für eine Sammel-SMS. STELLT EUCH VOR, ICH SEHE PLÖTZLICH ROSAROT. HAT WER SCHON VON SO EINER KRANKHEIT GEHÖRT? DAS IST KEIN SCHERZ.
 Druckversion
Druckversion
Ich ging ins Bett, konnte nicht einschlafen, wie auch. Selbst die Schwärze meiner geschlossenen Augen war von einem rosaroten Schimmer durchzogen, kitschig und penetrant. Schließlich starrte ich mit offenen Augen in die Leere und sogar diese erschien mir rosarot. Ich blieb wach, bis zum Morgen, an dem sich die rosa Helligkeit sich im Zimmer ausbreitete, zwischen den schmalen Spalten der Jalousien hervorkroch und sich über mich und um mich legte. Um sechs Uhr stand ich auf und schaute in den Spiegel, zum ersten Mal, seit ich rosarot sah.
Meine Haare glänzten, die Haut schimmerte. Ich weinte. Kleine, rosarote Perlen tropften in das etwas hellere Waschbecken und verfärbten meine Gefühle zu tiefem, endlosem Schwarz.
Auf dem Handy fand ich rund 20 Nachrichten, Fragen, ob es sich um einen Scherz handelte, was ich damit meinte oder schlichte Fragezeichen waren zu finden. Ich rief in der Firma an, meldete mich krank und ging zur Augenambulanz.
Ob ich Schmerzen hätte, fragte die Ärztin, ich verneinte. Stress, Bluthochdruck, frühere Krankheiten. Ich beantwortete alles wahrheitsgemäß, doch bei den Symptomen log ich, sagte nichts von dem rosarot, dem neuen, ständigen Begleiter, sondern sprach von einer plötzlichen Sehschwäche.
Nach der Anamnese wartete ich vier Stunden. Die Ärztin fand nichts, verschrieb Augentropfen, riet zu einem Termin bei einem Psychotherapeuten und überwies mich an einen Neurologen.
Zu Hause angekommen rief ich meine Eltern an. Die Mutter machte sich große Sorgen, obwohl sie selbst an einer unheilbaren Krankheit litt. Der Vater beruhigte, es würde schon alles wieder gut werden, das wären sicher die Computer, die wären schlecht.
Gebäude, Menschen, Autos, Hunde, Himmel, alles im selben Farbton. Ich ging durch eine viel zu helle, viel zu freundliche Welt, denn das Rosa tauchte alles in süße Unschuld.
In der Straßenbahn saß mir ein Mann gegenüber, sein Haar und sein Bart lang, zerzaust und verfilzt, seine Kleidung zerrissen. Von ihm ging ein Gestank aus und dennoch sog ich die Luft ein, wie um die Sicherheit aufzusaugen, dass es sich um einen Obdachlosen handelte und nicht um einen lustigen Clown, wie ich ihn sah.
Ich fürchtete mich vor dem ersten Blick, den ich auf meine Freundin werfen würde. Ihr Kleid, der Mantel, die Schuhe in hellem rosa, ihr Gesicht viel zärtlicher und weicher. Die Freundin umarmte mich und ich sagte, ist es ein Fluch, oder bin ich die Auserkorene? Oder einfach ein medizinisches Wunder? Du musst dich daran gewöhnen, sagte sie, bis es wieder vergeht, mach dir keine Sorgen, immerhin siehst du noch, es gibt Schlimmeres, ja, nickte ich, du hast wohl Recht und ich küsste sie.
Die Tage vergingen. Die Wochen. Drei. Vier.
Die rosa Marmelade, das rosa Fernsehbild, die rosa Menschen und ihre verschiedenen Schattierungen, meine rosa Haut, wenn ich in den Spiegel schaute. Ich konnte wieder lachen. Meine Freundin hatte Recht, es gab Schlimmeres, viel Schlimmeres. Manchmal fand ich es sogar besser. Denn während für andere die beginnenden Wintertage grau und feucht erschienen, waren meine von unbekümmerter Helligkeit. Hässliche Menschen waren witzige, übertriebene Karikaturen, sogar die kleine, scheue Putzfrau in der Firma umhüllte der rosarote Schein einer glücklichen Kindlichkeit. Wenn meine Freundin eine bekümmerte, traurige oder wütende Miene aufsetzte, erinnerte das Gesicht an die übertriebene Mimik eines strengen Lehrers, eine nicht ernst zu nehmende Angelegenheit. Die ersten Male lachte ich über sie, sie war gekränkt, schmollte und wirkte noch lächerlicher.
Eines Abends ging ich tanzen. Der Club wirkte wie ein Kinderzimmer und sogar die schwere elektronische Musik und der dumpfe Bass klangen nach unbeschwertem Tralala. Ich tanzte, ich hüpfte, ich lachte die Leute aus, die Typen, die an der Bar standen, doch die rosa Hemden, das rosa Haar und ihre rosige Haut machte sie zu Transen. Die Frauen glichen Puppen, zuckerlfarbige Bonbon-Gestalten mit Locken, geradem Haar und lächerlichen Haarbändern. Trotzdem war es schön, schön und einfach und ich tanzte weiter, tanzte, hob die Arme und senkte sie, meine rosaroten Arme.
Am nächsten Abend ging ich wieder hin. Und am nächsten und am nächsten auch. Am vierten Tag ging ich mit einem Mann nach Hause, fragte nicht nach seinem Namen, die Farbe tauchte ihn in eine eigenartige Weiblichkeit, verführerisch und unschuldig zugleich.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, fühlte ich mich wie eine Prinzessin neben einem unbekannten Prinzen. Am Nachmittag rief ich die Freundin an, am Abend war ich bei ihr und liebte sie, ich hatte kein schlechtes Gewissen, warum auch, das Leben war es nicht wert, mein Leben nicht, in rosarot gab es keine Traurigkeit und ehrlich war alles, was ich für richtig hielt.
Und so sank ich mit ihr, so sank ich mit ihm.
Als der Vater anrief und sagte, die Mutter liege im Sterben, war ich bei dem Mann, zum fünften Mal schon, Johannes ist mein Name, sagte er, doch ich lachte und nannte ihn Pink Panther. Ich fuhr zur Mutter ins Krankenhaus, der Vater warnte mich, bevor ich zu ihr ging, sie sehe schlecht aus, sagte er, schreck dich nicht.
Ich trat ein und Mutter sah mich an aus gütigen, rosaroten Augen, sie war noch immer ein Mädchen und obwohl der Krebs sie schmal gemacht hatte und die Wangen eingefallen waren, strahlte sie, ihre Haut noch immer rosig, ihr schütteres Haar weich und in einem fahlen altrosa. Ich lächelte und strich der Frau sanft über das Gesicht, Mama, flüsterte ich. Mutter war schön, nicht dem Tod, sondern einer Fee gleich, transzendent, durchscheinend, nicht von dieser Welt.
Mutter ist glücklich, sagte ich dem Vater, und sieht wunderschön aus. Er hatte rosarote Perlentränen in den Augen und sah mich groß an, siehst du nicht den Schmerz in ihrem Gesicht, fragte er atemlos und wandte sich ab, als würde er sich schämen.
Ich fuhr in die Stadt zurück, bei einem U-Bahnaufgang saß ein Kind mit ausgestreckten Händen, die einen Teller formten, bitte, sagte es, bitte. Alles klar, sagte ich und weil es so süß war gab ich ihm 50 Euro. Zuhause nahm mich meine Freundin in die Arme und sie fragte, ob es mir gut ginge, ob ich traurig wäre. Nein, antwortete ich, lass uns tanzen gehen.
Einige Tage später war Mutter tot. Menschen mit traurigen, ernsten Gesichtern in rosaroten, eleganten Gewändern, rosa Kränze, auf denen Sprüche standen, ein Meer an rosaroten Blumen und ein riesiger, rosaroter Stein auf dem „In ewiger Erinnerung“ eingraviert worden war. Warum seid ihr so traurig, fragte ich die Leute, wisst ihr nicht, dass Mutter jetzt eine Fee ist, ein zauberhaftes Wesen, zart und schwebend.
Der Vater schickte mich weg, er könne es nicht sehen, dass ich für die Mutter nicht eine Träne übrig hätte, ich zuckte mit den Schultern und ging.
Pink Panther rief an, wieder und wieder und wieder, ich hob nicht ab, er langweilte mich mit seinen fragenden, sehnsüchtigen Augen.
Die Nacht verbrachte ich dennoch bei ihm, er sagte, dass er mich liebte und ich nickte, ist gut, jaja, sagte ich, ich dich auch.
Zuhause standen die Koffer gepackt im Vorraum, sie könne nicht mehr, flüsterte meine Freundin, ich hätte es zerstört. Warum?, fragte ich. Du liebst mich nicht mehr, sagte die Freundin. Ich protestierte. Nur weil ich leben wollte? Meine Welt keine Traurigkeit kannte? Meine Mutter schön war, als sie starb? Weil ich keine Angst mehr hatte, vor dem nächsten Tag, vor den Menschen und ihren Schicksalen? Vor meinem eigenen? Keinen Ekel und kein Mitleid mehr fühlte? Was war schlecht daran? Was war schlecht an mir?
Die Freundin antwortete nicht und ich ging.
Es war zu kühl, um draußen zu übernachten und ich hatte Hunger, in den letzten Monaten hatte ich zugenommen, seit ich rosa sah, verwandelte sich jede Speise zu einem Festmahl und schmeckte süß.
Ich rief Pink Panther an. Drei Stunden später lag ich in seiner Badewanne voll watteweichem Schaum. Dazwischen blitzte im sanften Kerzenschein das rosa Wasser durch und ich wusste, dass ich ans Meer musste.
Ich fragte Pink Panther, ob er mich begleiten wolle und er überlegte. Ich kann nicht, sagte er, ich bin nicht wie du. Wie du willst, sagte ich, ich fliege morgen und brauche Geld.
Er lieh es mir, ohne ein Wort und ich flog.
Es regnete und ich starrte auf die tosenden Wellen des Atlantiks. Tag für Tag, von morgens bis abends und mir wurde nicht langweilig. In der kleinen Pension frühstückte ich ausgiebig, ging dann ans Meer und blieb, bis es dunkel wurde. Ich traf kaum Leute, aber das störte mich nicht, im Gegenteil, ich hatte ein rosarotes, glitzerndes Meer für mich. Am Abend kam ich zurück, durchnässt und glücklich.
Nach einigen Tagen hörte der Regen auf und wieder wartete ich geduldig, bis der Abend kam. Dann sank die Sonne. Verschwamm in einem tiefen, dunklen Rosarot, zu hell für Blut und zu dunkel für Zuckerwatte, gewaltig und wunderschön, tauchte sie tiefer in die glitzernde, rauschende See, die sie verschlang und ich musste mich anstrengen, um noch hinsehen zu können in die strahlende Schönheit des Horizonts. Ein Moment, an dem ich wusste, dass es nicht mehr zu sehen gab, nicht mehr zu entdecken.
Eine Silhouette löste sich aus dem Bild, zuerst nur sich bewegende Schatten, doch dann verwoben sie sich zu etwas Ganzem und eine Frau kam auf mich zu, es schien, als wäre sie direkt dem Horizont entstiegen.
Hallo, hauchte die Frau und ich hielt die Luft an, weil ich vor ihrer Schönheit kaum standhalten konnte. Hallo, flüsterte ich. Eine Weile blieb es so, die Frau stand vor mir, bis sie sich neben mich in den Sand setzte, wortlos.
Schön, was?, sagte die Frau und warf ihr Haar nach hinten und ich nickte. Wer sind Sie, fragte ich leise. Ich bin der Tod, antwortete die Frau. Hi. Die Frau streckte mir die Hand entgegen und ich nahm sie. Eine Frau, sagte ich. Ja, warum nicht. Der Tod, murmelte ich, der Tod. Jetzt schon?, fragte ich laut. Die Frau lächelte und sagte nein, ich hatte grad in der Gegend zu tun und ich komm gern da her.
Obwohl, entgegnete ich, heute wäre ein geradezu optimaler Tag zum Sterben. Sie nickte. Stimmt. Hm, sagte ich und seufzte. Ich sog die Luft ein, warum auch nicht. Können Sie mich einschieben, fragte ich die Frau und diese zuckte mit den Schultern. Klar, kein Problem, wo ich schon da bin.
Und die Frau legte den Arm um meine Schulter, so zärtlich und weich, dass ich es kaum spüren konnte und die Frau strich mein Haar zurück, sanft, und die Frau ließ mich in ihr Gesicht schauen, ihr wunderschönes Gesicht sehen, die weiße Haut und die dunkelbraunen Augen, der rote Mund und ihr nicht enden wollendes, in allen Farben glänzendes Haar. Gehen wir, sagte die Frau, ich nickte und wir küssten uns.
© Silvia Pistotnig
 Druckversion
Druckversion
Mehr über die Autorin
Bei den Eselsohren besprochen: „Nachricht von Niemand“

Silvia Pistotnig (© Bubu Dujmic)
Biografie

Silvia Pistotnig (© Bubu Dujmic)
Silvia Pistotnig, geboren 1977 in Klagenfurt, lebt und arbeitet in Wien. Sie studierte Publizistik und Politikwissenschaften an der Universität Wien und diplomierte im Jahr 2000. Bis 2005 arbeitete sie als Redakteurin im echo-Medienhaus und seither ist sie bei wien.at im Verlagshaus Bohmann tätig. Seit 2000 Mitglied der Autorinnengemeinschaft AGA und seit 2001 Mitglied der LiteratInnenvereinigung Podium.
Nebenbei arbeitet sie als Aerobictrainerin.
Auszeichnungen:
Sie erhielt dreimal das Arbeitsstipendium für Literatur des Bundesministeriums für Kunst und Kultur und 2010 den Förderpreis für Literatur des Landes Kärnten.
Veröffentlichungen:
Kurzgeschichten in Literaturzeitschriften wie „Podium“, „Sterz“, „Macondo“ (Deutschland), „Entladungen“ u.a., Zeitungen wie „Der Standard“ (Album) und „Datum“ sowie in den Bildbänden „En Détail. Alte Wiener Läden“ (hg. von Petra Rainer, Wien 2002) und „Wien im Lichte der Nacht“ (hg. von Andreas Brunner, Wien 2008).
Ihr Debütroman „Nachricht von Niemand“ wurde 2010 vom Skarabaeus-Verlag publiziert.
Mehr bei den Eselsohren
- von: AutorIn
- was: Eselsohren exklusiv – Neue Artikel
- wer/wie/wo: Pistotnig
 Druckversion
Druckversion