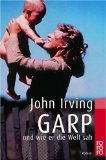Herbert Achternbusch
DER SOHN DES DIONYSOS
Hierzulande ist er weniger berühmt als berüchtigt – wegen seines angeblich blasphemischen Filmes „Das Gespenst“. Doch Herbert Achternbusch‘s Bücher, Filme und Bilder sind weniger provokant, weil sie eine bestimmte Anschauung vertreten, sondern weil sie zu eigenen Gedanken anregen könnten.
„In meinem Kopf geht alles so schnell“, schreibt der bayerische Autor, Filmemacher und Maler Herbert Achternbusch in seinem Buch „Der letzte Schliff“. Und wirklich, dieses Interview macht ihm so schnell keiner nach: Er sitzt auf der Burg Raabs auf einer Bank, hält gleichzeitig eine Art Generalprobe und besagtes Interview ab, ohne dass sich jemand ernsthaft vernachlässigt vorkommen könnte, – und hat währenddessen auch noch Muße, einige seiner vorbeikommenden Bekannten in Details verschiedener künstlerische Projekte einzuweihen. Das ist vielleicht nicht die Gesprächssituation, die sich ein Journalist erträumt, aber es ist typisch Achternbusch. So schreibt er auch und so sehen seine Filme und Bilder aus: eher dionysisch als apollonisch – sein Werk zeugt mehr von sinnlicher Erfahrung als von emotionaler Distanz und formaler Reinheit.
Das Klatschen einer Hand
Wohl nicht zufällig hat er den 3. Band seiner (schriftstellerischen) Gesamtausgabe „Mein Vater heißt Dionysos“ genannt, der wie alle Werke der letzten Jahre in der Bibliothek der Provinz erscheint. Deren Verleger, Richard Pils, veranstaltet jeden Spätsommer mit seinen Autoren das „Poetenfest“, welches heuer auch ein wahres Achternbusch-Fest war. Hier wurde seine Bilderserie „Ab nach Tibet“ und sein neuester Film „Das Klatschen der einen Hand“ gezeigt, hier wurden Ausschnitte aus seinem Theaterstück „Daphne aus Andechs“ sowie das Dramolett „Stefanie und Moses“ gespielt, hier wurde das eben erschienene Buch „Ist es nicht schön zu sehen wie den Feind die Kraft verlässt“ (mit gesammelten Zeitungsartikeln) vorgestellt.
Bei Gott keine Celebrity
Und wenn Sie sich jetzt vielleicht fragen, wieso Sie diesen vielseitigen Herbert Achternbusch nicht oder kaum kennen, so liegt das zum Teil daran, dass dieser sich öffentlich nicht gerne anders als durch seine Kunst ausdrückt, dass er sich vor der Öffentlichkeit auch schützen will und deshalb Talkshows, Lesungen und Ausstellungseröffnungen eher abgeneigt ist – Interviews sowieso. Zum anderen behauptet er glaubwürdig, „Einen Abend ohne Wirtshaus (mit obligatem Bier- und Schnupftabakkonsum; Anm.) finde ich gottlos!“
„Ich kann mich nur ausdrücken, damit bin ich unbrauchbar“
Was er allerdings nicht mag, und wohl am wenigsten im Wirtshaus: „Ein jeder Gesprächspartner bietet seine Mäntelchen aus Erklärungen an, damit man sich ein wenig darunterstehe, erwärme, freue und weiter wisse, wo es lang geht, haha.“ In „Der letzte Schliff“ beschreibt er sich so: „Du kannst dich informieren, sagte ich, du gibst Informationen weiter, das kann ich nicht. Ich kann mich nur ausdrücken, damit bin ich unbrauchbar, kaum jemand will etwas von mir.“ – Ja, Achternbusch ist keine Celebrity. Seine Bücher verkaufen sich vielleicht 2.000 Mal, seine Filme waren weder als Blockbuster noch als Autorenfilme konzipiert. Sie sind, wie die Bilder, typisch Achternbusch, auch wenn man dieses Typische schwer zu fassen bekommt.
Vom Vater adoptiert
Über biographische Angaben gar nicht, aber bitte sehr: Herbert Achternbusch wurde 1938 in München unehelich geboren, wuchs bei seiner Großmutter im Bayerischen Wald auf und wurde 1960 von seinem leiblichen Vater adoptiert. Nach der Matura studierte er Malerei, wurde als Schriftsteller von Martin Walser und Günter Eich gefördert, als Filmemacher von Werner Herzog, Volker Schloendorff und Margarethe von Trotta. Seither hat er mehr als 50 Bücher, über 20 Theaterstücke und 28 Filme herausgebracht. Obwohl sein Film „Das letzte Loch“ mehrfach ausgezeichnet wurde, erfuhr er die meiste Aufmerksamkeit durch die Blasphemie-Vorwürfe gegen seinen Film „Das Gespenst“ (1982), in dem eine Jesus-Figur vom Kreuz steigt und der in Österreich wegen „Herabwürdigung religiöser Lehren“ nicht gezeigt werden darf.
„In Bayern will ich nicht begraben sein“
Diese Vorwürfe sind für ihn bis heute genauso unverständlich und schmerzhaft wie die Aufregung um die Filmszene mit dem Satz „In Bayern will ich nicht begraben sein“. Das sei doch nur, sagt Achternbusch, eine Rückführung von Dialekt ins Hochdeutsche, wie es etwa schon eine Marieluise Fleißer angewandt habe (- aber dass ihn mit seiner Heimat eine leidenschaftliche Hassliebe verbindet, darf man schon konstatieren). Jedenfalls stürzte ihn die Aufregung um „Das Gespenst“ in eine Schaffenskrise, die zu einer Wiederentdeckung des Malens führte, nachdem man ihm das auf der Akademie nahezu ausgetrieben hatte (- „dort gab es nichts zu lernen, was über eine Beamtenanwaltschaft hinausgeht“).
Misslungen
Vom Verkauf seiner Bilder (sowie von den Tantiemen seiner Theaterstücke) konnte er sich, wenn schon nicht in Bayern, so doch im „nahen“ Waldviertel ein Haus kaufen. Seine letzten Drehbücher hat er in einem Buch mit dem Titel „Misslungen“ herausgebracht, was vielleicht ironisch gemeint ist und „erfolglos“ heißen könnte, denn: „Jetzt kommen‘s und sagen, dass meine Filme einflussreich waren! Warum haben‘s mir das nicht vor 20 Jahren gesagt?“ – Damals schrieb, produzierte und drehte Achternbusch Film auf Film – nahezu ohne jede Resonanz und oft ohne oder mit nur sehr wenig Budget. Und wenn er auch schnell ist, so sind zwei Wochen für einen abendfüllenden Film doch wahnsinnig wenig. Geld bekommen haben immer nur die Techniker und Laiendarsteller, die welches brauchten; Sepp Bierbichler oder Kirsten Dehne etwa wirkten aus Begeisterung und Freundschaft mit.
Verrückt und pathetisch, bierselig und fromm
Und wie sehen diese Filme nun aus? Nach Benjamin Heinrichs „verrückt und pathetisch, bierselig und fromm“. In „Das Klatschen der einen Hand“ (einer Billigst-Produktion in klassicher Stummfilmästhetik) plagen sich zwei Männer in Achternbusch‘s typischer „hypnotischer Monotonie a la Robert Wilson“ (Helmut Schödel) damit ab, einen großen, schweren Stein von einem Felsen in einen Teich zu kippen. Es ist völlig klar, dass sie sich vergebens verausgaben, und die ganze Zeit steht die Frage im Raum, ob sie das nicht selbst von Anfang an wissen und warum sie es überhaupt versuchen. – Schon die frühen Filme waren etwa für Martin Walser ein „Spiel, das einen Grad von Ernst annimmt, den die Wirklichkeit nie erreicht“, für Lotte Eisner „schmerzvolle Burlesken“, für Achternbusch „Grotesken“; und: „War ich beim Schreiben auch meinem Können näher, näher war ich beim Filmen meinem Herzen.“
Seine Altersvorsorge
Seine Theaterstücke hat er – augenzwinkernd? – „meine Altersvorsorge“ genannt. Denn „Theater interessiert mich überhaupt nicht, weil das ist eine Institution, die viel Geld hat und durch das viele Geld müssen sie immer schauen, dass sie Ideen haben, und darum ist alles so krampfhaft, während im Film hat man eine Idee und muss unbedingt Geld auftreiben“. Bei seinen eigenen Stücken (gesammelt in „Die Einsicht der Einsicht“) kann man gleichsam zusehen, wie die Theaterillusion hergestellt wird, wodurch ein eigentümlicher Schwebezustand zwischen Distanziert- und Direktheit entsteht.
Zuihitsu
Eigentlich lässt sich Achternbusch immer dabei zusehen, wie er seine Kunst produziert. Seine Bücher beschreibt er so: „Einfälle zu haben, und sich nicht daran zu wärmen und eine irgendwie passende Stelle für sie später zu finden, sondern sofort und brühwarm aufzuschreiben.“ Oder: „Ich sehe nur zu, was da herauswill, und stelle mich zur Verfügung.“ – War man über diesen Stil anfangs empört und/oder ratlos (Heinrich Böll: „Der Zusammenhang wird gesucht, nicht gefunden“; Reinhard Baumgart: „Hier versucht jemand das letztlich Unmögliche: sich selbst, seine Erfahrungen unmittelbar zu Papier zu bringen, ohne den Umweg über den schönen Schwindel von erfundenen Geschichten oder mit dem strengeren Schwindel der Selbstreflexion“; Reinhold Grimm: „Unverfrorener hat sich wohl selten ein Pfuscher zum Schriftsteller aufgeworfen), so hat der Autor dafür mittlerweile sogar eine Kategorie gefunden: „Ich lasse mir mein Zuihitsu nicht nehmen“. – Das japanische „Zuihitsu” bedeutet „dem Pinsel folgend” und weist auf Schriften hin, die aus spontaner Eingebung Eindrücke, Erfahrungen und Überlegungen skizzenhaft zu Papier bringen.
„Bitte nicht drei Tage für ein Bild, das ist altmodisch!“
Ob das auch für seine – wie sein gesamtes Werk ungeschliffen wirkenden – Bilder gilt? Er selbst behauptet: „Eigentlich ist das keine Malerei, sondern ein unbewußter Erkenntnisdrang, der mich von Bild zu Bild treibt.“ Oder: „Ein Bild ist ja das Persönlichste, was eine Person mitteilen kann“.
Achternbusch malt natürlich schnell: „Ein Bild an einem Tag ist gut, aber bitte nicht drei Tage für ein Bild, das ist altmodisch!“ Nur ist dieser Maler/Autor/Filmemacher, von dessen Kunst laut Böll ein „existenzieller Sog“ ausgeht, mit ein paar Schlagworten wie eben „schnell“ (oder „wild grinsender Unzeitgeist“, „Amokdichter“, „Bierphantasien“, „Antilogik“) bestimmt nicht zu fassen. Mitten im lustvollen Treiben während des Interviews hält er kurz inne, als er hört, dass dies ein Porträt werden soll: „Ein Porträt … das versuch‘ ich auch schon so lange.“
Keine Chance
Über Achternbusch zu schreiben ist jedenfalls genau so, wie sich seine Kunst zu Gemüte zu führen: Manchmal bildet man sich ein, ihn/sie „eingefangen“ zu haben oder zu verstehen, doch schon im nächsten Moment steht man ihm/ihr ratlos gegenüber. Das macht nichts. Einer seiner bekanntesten Sätze lautet: „Du hast keine Chance, aber nutze sie“, ein weniger bekannter: „Das ist eine schöne Aufgabe der Literatur, andere zum Aussagen ihrer eigenen Gedanken zu bringen, die sie noch gar nicht kennen.“
© Magazin morgen, 2002
Mehr über Herbert Achternbusch bei Wikipedia,
Mehr KünstlerInnen-Porträts von Werner Schuster.